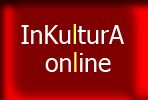Buchkritik -- Ian Rankin -- Die dunkelste Stunde der Nacht
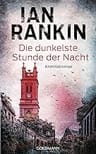 John Rebus ist alt geworden, aber nicht leise. Und das ist gut so. Denn was wäre ein Rebus-Roman ohne den Widerspruch zwischen moralischer Starrsinnigkeit und körperlicher Gebrechlichkeit, zwischen Pflichtgefühl und Selbstzerstörung? Ian Rankin, der Schotte mit dem Gespür für das schmutzige Herz von Edinburgh, schickt seinen legendären Ermittler im fünfundzwanzigsten Band der Reihe dorthin, wo die Gesellschaft ihre Schatten entsorgt: ins Gefängnis.
John Rebus ist alt geworden, aber nicht leise. Und das ist gut so. Denn was wäre ein Rebus-Roman ohne den Widerspruch zwischen moralischer Starrsinnigkeit und körperlicher Gebrechlichkeit, zwischen Pflichtgefühl und Selbstzerstörung? Ian Rankin, der Schotte mit dem Gespür für das schmutzige Herz von Edinburgh, schickt seinen legendären Ermittler im fünfundzwanzigsten Band der Reihe dorthin, wo die Gesellschaft ihre Schatten entsorgt: ins Gefängnis.
Der alte Polizist, inzwischen offiziell im Ruhestand, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, ausgerechnet wegen des versuchten Mordes an seinem jahrzehntelangen Gegenspieler Morris Gerald Cafferty, einem Gangster, der Rebus stets zugleich verachtet und gebraucht hat. Nun sitzt er ein, körperlich angeschlagen, aber geistig ungebrochen. Während er auf die Entscheidung über seine Berufung wartet, geschieht ein Mord in seiner Zelle und Rebus, der auch als Gefangener nicht anders kann, als zu ermitteln, stürzt sich in die Aufklärung.
Natürlich ist das, realistisch betrachtet, kaum denkbar. Ein pensionierter Kommissar, verurteilt, inhaftiert und trotzdem frei genug, im Gefängnis zu ermitteln? Man muss, wie Rankin-Leser seit jeher, bereit sein, die Plausibilität zugunsten der psychologischen Glaubwürdigkeit aufzugeben. Denn darum geht es hier: nicht um Kriminalistik, sondern um Haltung. Rebus’ Drang, Dinge zu verstehen, Menschen zur Rede zu stellen, selbst wenn er keine Autorität mehr besitzt, ist Ausdruck einer tiefen existenziellen Unruhe, der Unfähigkeit, sich mit der Welt abzufinden, selbst wenn sie ihn längst verurteilt hat.
Parallel dazu entspinnt Rankin eine zweite Handlungsebene außerhalb der Gefängnismauern. Rebus’ frühere Kollegin Siobhan Clarke sucht nach einem verschwundenen 14-jährigen Mädchen, und stößt auf eine Sex-Webcam-Plattform, auf der das Kind sich selbst zur Schau stellt. Es ist eine Nebenhandlung, die man fast für zu viel halten könnte, doch sie öffnet das Tor zu einem anderen Thema: der Verwischung von Schuld und Opferrolle in der digitalen Welt. Das Verbrechen ist längst nicht mehr das, was sich in dunklen Gassen abspielt, sondern das, was sich im grellen Schein der Selbstinszenierung verbirgt.
Rankin gelingt hier eine bittere Gegenüberstellung: Drinnen der Gefangene, der nach Wahrheit sucht; draußen die Welt, die ihre eigene Gefangenschaft kaum bemerkt. Zwischen beiden Sphären zieht sich eine unsichtbare Linie aus Korruption, Zynismus und moralischer Abstumpfung. Rebus bleibt, auch eingesperrt, der letzte Vertreter einer Ethik, die nicht von Regelbüchern, sondern von Gewissen geleitet wird.
Dass der Autor seinen Helden im hohen Alter noch einmal so radikal in die Enge führt, ist mehr als ein dramaturgischer Kunstgriff: Es ist ein Kommentar zur ganzen Gattung. Der klassische Ermittler, einst Symbol rationaler Ordnung, ist hier längst selbst zum Verdächtigen geworden. Rebus steht für eine aussterbende Spezies, den alten, widerspenstigen Mann, der die Welt nicht mehr versteht, aber gerade dadurch ihr einziger Zeuge bleibt.
Ja, man muss dem Plot manches verzeihen. Aber man liest Rankin nicht wegen der Wahrscheinlichkeit, sondern wegen der Menschlichkeit. Seine Sprache bleibt trocken, seine Dialoge lakonisch, seine Figuren glaubwürdig in ihrer Müdigkeit. Der Schauplatz Gefängnis ist kein Gimmick, sondern die logische Konsequenz eines langen moralischen Wegs: Wer jahrzehntelang gegen das Böse kämpft, wird irgendwann Teil davon.
„Die dunkelste Stunde der Nacht“ ist somit auch ein Requiem, nicht nur auf Rebus, sondern auf eine Welt, in der noch jemand wusste, was richtig und falsch war, auch wenn es niemand hören wollte. Der Roman ist düster, manchmal überkonstruiert, aber durchzogen von jener elegischen Wärme, die Rankin immer dann erreicht, wenn er seine Figuren scheitern lässt, ohne ihnen das Scheitern übelzunehmen.
Dass Band 25 einer Reihe, die 1987 begann, noch immer nicht müde wirkt, grenzt an ein literarisches Wunder. Vielleicht, weil Rebus selbst nie ruht. Vielleicht aber auch, weil Rankin begriffen hat, dass das wahre Verbrechen nicht der Mord ist, sondern das Nachlassen der moralischen Empörung.
Ein Krimi also, ja, aber einer, der die Grenzen des Genres sprengt. Und der zeigt, dass ein Gefängnis manchmal der einzige Ort ist, an dem Freiheit noch denkbar bleibt.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 6. November 2025