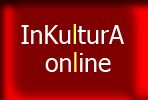Buchkritik -- Gustavo Faverón Patriau -- Unten leben
 Es gibt Romane, die gelesen werden wollen, und solche, die einen verschlingen. „Unten leben“ von Gustavo Faverón Patriau gehört entschieden zur zweiten Kategorie. Was der peruanische Autor hier vorlegt, ist ein Werk von beunruhigender Monumentalität, ein erzählerisches System, das sich eher wie ein geologisches Schichtmodell lesen lässt als wie eine lineare Geschichte. Der Leser steigt hinein, nicht voran; er dringt tiefer, nicht weiter.
Es gibt Romane, die gelesen werden wollen, und solche, die einen verschlingen. „Unten leben“ von Gustavo Faverón Patriau gehört entschieden zur zweiten Kategorie. Was der peruanische Autor hier vorlegt, ist ein Werk von beunruhigender Monumentalität, ein erzählerisches System, das sich eher wie ein geologisches Schichtmodell lesen lässt als wie eine lineare Geschichte. Der Leser steigt hinein, nicht voran; er dringt tiefer, nicht weiter.
Faverón entwirft kein Epos, sondern eine Katakombe. Seine Erzählung wuchert in Stimmen, Fragmenten, Chronologien, die sich über ein Jahrhundert und mehrere Kontinente spannen. Die Architektur des Romans ist labyrinthisch, ja bewusst desorientierend. Ein Geflecht aus Erinnerungen, Verhörräumen, Gefängnissen und Erzählungen im Erzählten. Der Autor mutet seinem Leser die Orientierungslosigkeit zu, und macht sie zum Prinzip seiner Poetik. Wer sich darauf einlässt, erfährt ein Sinken, kein Fortschreiten. Ein literarisches Labyrinth, das aus dem Vorankommen ein Zurückgehen, glweichsam ein kafkaeskes Umkreisen provoziert.
Im Zentrum steht die Gewalt, nicht als Sujet, sondern als anthropologische Konstante. Diktaturen, Folter, politische Obsessionen und religiöse Entgleisungen. Der Autor kartographiert das lateinamerikanische Jahrhundert als eine Landschaft des Schreckens. Doch er moralisiert nicht. Der Roman ist keine Anklage, kein Tribunal; er verweigert sich jeder moralischen Belehrung. Das Böse erscheint als evolutionäre Tatsache, sedimentiert in den Körpern, den Familien, den Archiven. Aus dieser Haltung entsteht eine eigentümliche Intensität: Das Grauen wird nicht erklärt, es wird erinnert, geträumt und geflüstert.
Unter dieser historischen Oberfläche liegt eine zweite, intimere Schicht, die der Vererbung. Väter, Söhne, genealogische Schulden, Der Roman ist auch eine Studie über das Fortleben des Wahnsinns, über die unheilvolle Wiederkehr des Traumas. Faverón zeigt, wie die Gewalt der Geschichte in die Familienbiographie sickert, wie sie die Kinder deformiert, bis sie die Wunden der Väter nachzeichnen. Das Ganze hat etwas Mythisches, fast Alttestamentarisches. Doch der Symbolismus ist so dicht, dass er zuweilen ins Allegorische kippt, nicht immer gelingt die Balance zwischen Erkenntnis und Überfrachtung.
Formal zeigt sich Faverón als Virtuose. Sein Roman ist Enzyklopädie und Mysterium, Kriminalfall und Metaphysik, Realismus und Groteske zugleich. Er verbindet das Archivarische mit dem Fantastischen, das Dokument mit dem Delirium. Die Sprache bewegt sich zwischen chirurgischer Präzision und halluzinatorischer Überhitzung, zwischen ironischer Distanz und eruptiver Bildkraft. Das ist bewundernswert, und gelegentlich anstrengend. Man spürt den Willen zur Totalität, der jedes Fragment absorbieren will.
Gerade darin liegt aber auch die Ambivalenz dieses Buches. Seine unerschöpfliche Intertextualität, das permanente Zitieren, die kulturelle Selbstreflexion, das Spiel mit Fiktionen innerhalb der Fiktion, erzeugt einen Sog, der ebenso faszinierend wie erschöpfend ist. Man fragt sich, ob der Autor der eigenen Erzählmacht noch traut oder sie nur noch als Experiment betreibt. „Unten leben“ ist kein Roman über Gewalt, sondern ein Roman über das Erzählen von Gewalt, und über das Versagen jeder Sprache angesichts dessen.
In den stärksten Passagen gelingen Faverón Bilder von beklemmender Intensität. Die Keller, die Irrenhäuser, die Archive, in denen die Geschichte fault; die Stimmen der Verschwundenen, die wie Echochöre aus der Tiefe steigen. Diese Topographie des Unterirdischen verleiht dem Werk seine eigentliche Dimension. Das „Unten leben“ des Titels ist kein Ort, sondern ein Zustand, das Bewusstsein des Menschen, der in der Dunkelheit seiner eigenen Geschichte wohnt.
Strukturell erweist sich der Roman als präzise komponiert. Vier Teile, vier Bewegungen, die am Ende ein Netz ergeben, in dem jedes Fragment seinen Platz findet. Doch das Kalkül der Struktur wird überlagert vom Furor der Erzählung. Die Prosa wächst wie ein Organismus, sie frisst ihre eigenen Ränder. Das ist ihre Schönheit – und ihr Problem. Man bewundert die Konstruktion und fragt sich zugleich, ob sie nicht an ihrer eigenen Grandiosität zerbricht.
Was bleibt, ist ein Werk von seltener Konsequenz. Ein intellektueller Monolith, der sich der unmittelbaren Emotionalität ebenso entzieht, wie er sie provoziert. „Unten leben“ verlangt nicht Zustimmung, sondern viel Ausdauer. Es ist ein Roman, der gelesen werden will wie man eine Mine betritt, mit Lampen, mit Vorsicht, mit der Ahnung, dass man Spuren von sich zurücklassen wird.
Faverón Patriau hat ein Buch geschrieben, das sich zwischen die großen Traditionen des lateinamerikanischen Romans und die postmoderne Weltliteratur schiebt, ohne sich einer Seite anzubiedern. Es ist ein Werk, das mehr wagt, als es leisten kann, und gerade deshalb bewundernswert bleibt. Man verlässt es nicht unversehrt. Wer es gelesen hat, weiß, was es heißt, unten zu leben.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 26. Okrober 2025