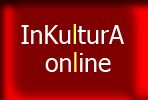Buchkritik -- Manuel Ostermann -- Deutschland ist nicht mehr sicher
 „Deutschland ist nicht sicher“ von Manuel Ostermann zeichnet ein klares Bild der aktuellen Sicherheitslage in der Bundesrepublik, indem es wesentliche Defizite bei Respekt, Ausrüstung und politischer Unterstützung der Polizei offenlegt. Schon zu Beginn des Buches verweist Ostermann auf empirische Erhebungen, die belegen, dass das Vertrauen in die Polizei in den vergangenen Jahren merklich gesunken ist. Er erklärt, wie mediale Berichterstattung und vereinzelte Vorfälle von Fehlverhalten das Bild der Einsatzkräfte in der öffentlichen Wahrnehmung trüben, und welche Konsequenzen dies für die Zusammenarbeit von Polizei und Bürgerschaft hat. Anhand von Interviews mit Polizeibeamten zeigt er, welche Frustration entsteht, wenn grundlegende Höflichkeitsformen und Rückhalt im Dienst versiegen. Damit legt er den Grundstein für das Verständnis, weshalb eine funktionierende Sicherheitsarchitektur auf ein Mindestmaß an gegenseitigem Respekt angewiesen ist.
„Deutschland ist nicht sicher“ von Manuel Ostermann zeichnet ein klares Bild der aktuellen Sicherheitslage in der Bundesrepublik, indem es wesentliche Defizite bei Respekt, Ausrüstung und politischer Unterstützung der Polizei offenlegt. Schon zu Beginn des Buches verweist Ostermann auf empirische Erhebungen, die belegen, dass das Vertrauen in die Polizei in den vergangenen Jahren merklich gesunken ist. Er erklärt, wie mediale Berichterstattung und vereinzelte Vorfälle von Fehlverhalten das Bild der Einsatzkräfte in der öffentlichen Wahrnehmung trüben, und welche Konsequenzen dies für die Zusammenarbeit von Polizei und Bürgerschaft hat. Anhand von Interviews mit Polizeibeamten zeigt er, welche Frustration entsteht, wenn grundlegende Höflichkeitsformen und Rückhalt im Dienst versiegen. Damit legt er den Grundstein für das Verständnis, weshalb eine funktionierende Sicherheitsarchitektur auf ein Mindestmaß an gegenseitigem Respekt angewiesen ist.
Im Anschluss befasst sich Ostermann mit den Herausforderungen, die aus dem Zuzug von Menschen erwachsen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht anerkennen. Er stützt sich dabei auf Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sowie auf Behördenberichte, die belegen, dass nicht alle Zuwanderer bereit sind, sich den geltenden Rechtsnormen unterzuordnen. Dabei bleibt der Autor sachlich. Er argumentiert, dass die Integrationspolitik der letzten Jahre zwar große Leistungen vollbracht habe, zugleich jedoch Kontrollmechanismen fehlen, um eine grundlegende Wertekohärenz sicherzustellen. Ostermann verweist auf konkrete Polizeieinsätze, in denen kulturelle Missverständnisse und Wertedivergenzen zu Eskalationen geführt haben und er plädiert für gezieltere Programme, die beide Seiten, Schutzsuchende und aufnehmende Gesellschaft, besser zusammenbringen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der mangelhaften Ausstattung der Polizei. Ostermann dokumentiert, wie in verschiedenen Bundesländern ungleiche Ressourcenverteilungen dafür sorgen, dass manche Dienststellen mit moderner Technik arbeiten, während andere noch auf veraltete Funkgeräte und unzureichend geschützte Fahrzeuge angewiesen sind. Er wertet Haushaltsdaten aus den vergangenen zehn Jahren aus und zeigt, dass der Anteil der Mittel für Innenressorts im Verhältnis zum Gesamtetat zurückgegangen ist, obwohl die Aufgaben der Polizei erheblich komplexer geworden sind. Berichte von Kolleginnen und Kollegen schildern, wie Einsätze unter suboptimalen Bedingungen ablaufen müssen, ein Umstand, der nicht nur die Effektivität, sondern auch die Sicherheit der Beamten und der Bevölkerung gefährdet.
In seinem Kapitel über die politische Debatte analysiert Ostermann die Positionen von Grünen und Linken, die in Teilen auf eine Reduzierung oder Umstrukturierung der Polizei drängen. Er fasst die entsprechenden Parteiprogramme zusammen und ordnet sie in den Kontext breiterer reformerischer Forderungen ein. Dabei zeigt er auf, dass eine vollständige Abschaffung der Polizei, wie sie vereinzelt gefordert wird, nicht nur unrealistisch, sondern potenziell riskant wäre. Mit anderen Worten, ein Rückzug der Exekutive führt zu Anarchie und Chaos. Seiner Auffassung nach bedarf es eher einer sachlichen Reform, bei der fehlende Kompetenzen ergänzt und ineffiziente Strukturen abgebaut werden, statt die Institution grundlegend infrage zu stellen.
Im letzten Teil des Buches zieht der Autor Bilanz aus den offiziellen Kriminalstatistiken. Er zeigt, dass Deutschland in den zurückliegenden Jahren einen Anstieg bei Gewaltdelikten verzeichnet hat, der über das übliche Meldeverhalten hinausgeht. Ostermann beleuchtet dabei vor allem die Tendenzen in Ballungsräumen, wo die organisierte Bandenkriminalität das zentrale Probleme darstellt. Er weist darauf hin, dass eine moderne Sicherheitsstrategie nicht allein auf klassischen Polizeistrukturen beruhen kann, sondern interdisziplinäre Konzepte erfordert.
Unterm Strich präsentiert Ostermann ein sachlich fundiertes Plädoyer dafür, die Polizei nicht nur angemessen auszustatten, sondern ihr zugleich gesellschaftlichen Rückhalt zu sichern. Sein Buch verzichtet auf überzogen dramatische Formulierungen und bleibt durchgehend nüchtern in der Sprache. Es verzichtet bewusst auf populistische Vereinfachungen, indem es sowohl strukturelle Mängel benennt als auch praktikable Lösungsvorschläge anbietet. Dabei wird deutlich, dass Innenpolitik und Gesellschaft in der Pflicht stehen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsbehörden wieder handlungsfähig und gesellschaftlich anerkannt werden. Wer sich einen präzisen Überblick über die aktuellen Mängel und Handlungsoptionen verschaffen möchte, findet in „Deutschland ist nicht sicher“ einen fundierten, gut strukturierten Beitrag zur Debatte um die innere Sicherheit.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 23. Juli 2025