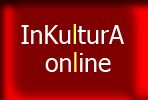Buchkritik -- Ian McEwan -- Was wir wissen können
 Ian McEwan, seit langem als einer der präzisesten und intellektuell scharfsinnigsten Autoren der englischsprachigen Gegenwartsliteratur etabliert, legt mit „Was wir wissen können“ ein Werk vor, das als ein Opus magnum seines Spätwerks gelten darf. Es ist ein Roman von außerordentlicher literarischer Kraft und handwerklicher Perfektion, der die Grenzen von Genres souverän überschreitet und dabei eine tiefgreifende philosophische Untersuchung mit einer fesselnden Erzählung verwebt. McEwan gelingt hier das seltene Kunststück, ein Buch zu schreiben, das zugleich als spekulative Fiktion, als akademischer Kriminalroman und als psychologisch dichtes Ehedrama funktioniert und auf jeder dieser Ebenen restlos überzeugt. Der Titel selbst ist dabei Programm und formuliert die zentrale epistemologische Frage, die wie ein Leitmotiv durch die komplexe Struktur des Romans schwingt: Was können wir wirklich wissen in einer Welt, die einerseits von Datenfluten überschwemmt wird und andererseits von unüberbrückbaren Gräben zwischen den Epochen und den Menschen gezeichnet ist?
Ian McEwan, seit langem als einer der präzisesten und intellektuell scharfsinnigsten Autoren der englischsprachigen Gegenwartsliteratur etabliert, legt mit „Was wir wissen können“ ein Werk vor, das als ein Opus magnum seines Spätwerks gelten darf. Es ist ein Roman von außerordentlicher literarischer Kraft und handwerklicher Perfektion, der die Grenzen von Genres souverän überschreitet und dabei eine tiefgreifende philosophische Untersuchung mit einer fesselnden Erzählung verwebt. McEwan gelingt hier das seltene Kunststück, ein Buch zu schreiben, das zugleich als spekulative Fiktion, als akademischer Kriminalroman und als psychologisch dichtes Ehedrama funktioniert und auf jeder dieser Ebenen restlos überzeugt. Der Titel selbst ist dabei Programm und formuliert die zentrale epistemologische Frage, die wie ein Leitmotiv durch die komplexe Struktur des Romans schwingt: Was können wir wirklich wissen in einer Welt, die einerseits von Datenfluten überschwemmt wird und andererseits von unüberbrückbaren Gräben zwischen den Epochen und den Menschen gezeichnet ist?
Das narrative Gerüst des Romans ist ebenso kühn wie elegant konstruiert. Der erste Teil versetzt uns in das Jahr 2119, in eine Welt, die von den Katastrophen des 21. Jahrhunderts gezeichnet ist. Die „Disruption“, eine durch einen nuklearen Zwischenfall ausgelöste Flutkatastrophe, hat das Vereinigte Königreich in eine Ansammlung von Inseln, eine „Archipel-Republik“, verwandelt und die Weltbevölkerung drastisch reduziert. In dieser post-apokalyptischen Szenerie folgen wir dem Literaturwissenschaftler Thomas Metcalfe, einem der letzten seiner Zunft, der sich auf die Ära von 1990 bis 2030 spezialisiert hat, unsere unmittelbare Vergangenheit und Gegenwart. Metcalfes Blick auf unsere Zeit ist von einer ambivalenten Nostalgie geprägt; er sehnt sich nach der vitalen, „lauten“ Welt, die er nur aus den Archiven kennt, während seine Studenten unsere Epoche als die der „ignoranten, schmutzigen und destruktiven Rüpel“ abtun. Diese Spannung zwischen einer idealisierten Vergangenheit und ihrer tatsächlichen Verantwortungslosigkeit ist eine der zentralen Achsen des Romans. Metcalfes akademische Obsession gilt einem singulären literarischen Mysterium: dem Verbleib eines verschollenen Gedichts mit dem Titel „Sonettenkranz für Vivien“, verfasst von dem fiktiven, mit Seamus Heaney verglichenen Dichterfürsten Francis Blundy. Dieses als Meisterwerk geltende Sonett-Zyklus wurde 2014 auf einer Dinnerparty einmalig vorgetragen und ist seither verschollen, was es zum Gral der Literaturwissenschaftler des 22. Jahrhunderts macht.
An diesem Punkt entfaltet der Roman seine epistemologische Kernproblematik. In Metcalfes Zeit sind die digitalen Archive unserer Tage, E-Mails, Browserverläufe, Social-Media-Posts, vollständig erhalten und zugänglich. Die Menschheit des 22. Jahrhunderts hat, wie es im Roman heißt, „die Vergangenheit ihrer Privatsphäre beraubt“. Metcalfe kennt die intimsten Details der Protagonisten des Jahres 2014, vom Lieblingssnack des Dichters bis zu den medizinischen Diagnosen seiner Frau. Doch diese totale Information führt nicht zu wahrem Verständnis. McEwan demonstriert meisterhaft, wie Metcalfe trotz seiner erdrückenden Datenfülle die menschliche Wahrheit hinter dem Mythos des Gedichts fundamental missversteht. Er rekonstruiert ein Bild, das von seinen eigenen Sehnsüchten und Projektionen geprägt ist, und scheitert grandios an der Komplexität der emotionalen Realität. Der Roman wird so zu einer tiefsinnigen Meditation über den Unterschied zwischen Daten und Weisheit, zwischen Information und Erkenntnis. Das komische und zugleich tragische Scheitern des Biografen wird zur Parabel auf die Grenzen des Wissens an sich.
Die volle Wucht dieser Thematik entlädt sich in der zweiten Hälfte des Buches, die einen radikalen Perspektivwechsel vollzieht und uns ins Zentrum des Geschehens im Jahr 2014 versetzt. Aus der Sicht von Vivien Blundy, der Ehefrau des Dichters und Adressatin des berühmten Gedichts, erleben wir die Ereignisse, die Metcalfe ein Jahrhundert später zu rekonstruieren versucht. Dieser strukturelle Kniff ist von atemberaubender Wirkung. McEwan dekonstruiert den im ersten Teil sorgfältig aufgebauten Mythos und enthüllt eine weitaus profanere, schmutzigere und menschlichere Wahrheit. Der gefeierte Poet entpuppt sich als monströser Narzisst und emotionaler Betrüger, dessen Kunst nicht aus einem tiefen Natur- oder Liebesempfinden, sondern aus einem Mangel und einer Fälschung erwächst. Die legendäre Dinnerparty ist keine Feier der hohen Kunst, sondern eine Bühne für Ehebruch, Verrat und verletzte Gefühle. Diese Enthüllung ist keine bloße Pointe, sondern das Herzstück des Romans, in dem McEwan seine ganze Meisterschaft in der psychologischen Charakterzeichnung ausspielt.
Auf einer noch höheren Ebene der Abstraktion gelingt McEwan hier eine brillante metaphorische Verknüpfung, die einen der innovativsten Aspekte des Romans darstellt: Er inszeniert die Klimakrise als eine Geschichte des Ehebruchs. Unsere Generation, die „Alten“ aus der Sicht des 22. Jahrhunderts, verhält sich gegenüber dem Planeten und den nachfolgenden Generationen wie ein untreuer Ehepartner. Wir besingen die Schönheit der Natur in unserer Kunst, so wie Francis Blundy in seinem Gedicht, betrügen sie aber durch unser rücksichtsloses Handeln. Wir geben ein Versprechen, das wir nicht halten. Diese Untreue stürzt die Nachkommen in ein unauflösbares Dilemma: Sie sind gefangen zwischen der Sehnsucht nach einer verlorenen, reichen Vergangenheit und der Verachtung für die moralische Fahrlässigkeit derer, die sie ihnen geraubt haben. Das Konzept des „Derangement“, das der Roman für dieses kollektive Versagen der Menschheit einführt, beschreibt nicht nur die Zerrüttung der Ökosysteme, sondern auch eine tiefgreifende kognitive und moralische Störung, die Unfähigkeit, langfristige Konsequenzen gegenüber kurzfristigem Komfort abzuwägen.
Darüber hinaus erweist sich „Was wir wissen können“ als ein subtil selbstreflexives Werk, das die Grenzen des liberalen Humanismus und des realistischen Erzählens selbst in den Blick nimmt. Metcalfes nostalgische Verklärung unserer Epoche, die deren destruktives Potenzial ausblendet, kann als Kritik an einer liberalen Weltsicht gelesen werden, die für ihre eigenen blinden Flecken anfällig ist. Der Roman stellt durch seine Figuren sogar die Frage, ob der traditionelle Realismus überhaupt noch eine adäquate Form ist, um die moralischen und physischen Konsequenzen einer globalen Katastrophe darzustellen. McEwan beantwortet diese Frage, indem er die Mittel des Realismus virtuos einsetzt, sie aber in ein spekulatives Gerüst einbettet, das ihre Reichweite und ihre Grenzen zugleich aufzeigt.
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass „Was wir wissen können“ ein literarisches Ereignis darstellt. Es ist ein Roman, der mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks konstruiert ist und dabei eine intellektuelle und emotionale Tiefe erreicht, die ihresgleichen sucht. McEwan gelingt eine philosophisch aufgeladene Tour de Force, die den Leser fesselt, herausfordert und am Ende nicht mit einfachen Antworten, sondern mit den drängenden, schmerzhaften Fragen unserer Zeit entlässt. Es ist die Arbeit eines Schriftstellers auf dem Höhepunkt seines Schaffens, der uns zwingt, darüber nachzudenken, was wir wissen können, was wir zu ignorieren beschließen und welche verheerenden Konsequenzen diese Entscheidung hat. Das Buch ist nicht weniger als ein Meisterwerk, das die literarische Landschaft seiner Zeit prägen wird.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 16. Oktober 2025