Buchkritik -- Sten Nadolny -- Herbstgeschichte
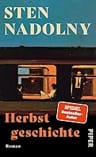 Sten Nadolny hat mit seiner „Herbstgeschichte“ wieder einmal jenes Kunststück vollbracht, das man heutzutage fast für ausgestorben hält: Er schreibt einen Roman, der weder nach Aufmerksamkeit heischt noch sich mit dramaturgischen Klimmzügen wichtig macht. Stattdessen setzt er auf jene Form der literarischen Souveränität, die man nur entwickeln kann, wenn man lange genug im Geschäft ist, um dem Lärm der Gegenwart mit einem müden Lächeln zu begegnen.
Sten Nadolny hat mit seiner „Herbstgeschichte“ wieder einmal jenes Kunststück vollbracht, das man heutzutage fast für ausgestorben hält: Er schreibt einen Roman, der weder nach Aufmerksamkeit heischt noch sich mit dramaturgischen Klimmzügen wichtig macht. Stattdessen setzt er auf jene Form der literarischen Souveränität, die man nur entwickeln kann, wenn man lange genug im Geschäft ist, um dem Lärm der Gegenwart mit einem müden Lächeln zu begegnen.
Im Zentrum steht eine Freundschaft, die man im echten Leben vermutlich längst für ein Relikt vergangener Zeiten halten würde: Ein Schriftsteller und ein Schauspieler, zwei Männer, die nicht damit beschäftigt sind, sich permanent als Marke zu inszenieren, sondern ganz altmodisch versuchen, das Leben zu begreifen. Dass ihnen ausgerechnet eine junge, rätselhaft schillernde Frau in die Quere kommt, verleiht der Geschichte jenes Element der Irritation, das nötig ist, damit sich überhaupt noch etwas bewegt. Nadolny inszeniert dieses Dreieck jedoch nicht im Stil der boulevardesken Erregungsindustrie, sondern mit jener ruhigen Präzision, die den Leser eher in einen kontemplativen Zustand als in nervöses Umblättern versetzt.
Die Zeit verläuft bei Nadolny ohnehin nicht linear, sondern wie eine launische Katze: mal streicht sie um die Figuren, mal entfernt sie sich, mal springt sie unvermittelt zurück. Dieser spielerische Umgang mit Chronologie und Perspektive ist kein Gimmick, sondern Ausdruck eines tiefen Vertrauens in die eigene Erzählkraft. Während andere Autoren solche Techniken nutzen, um ihre intellektuelle Muskelmasse vorzuführen, bleibt Nadolny nüchtern und gelassen. Er weiß, dass Komplexität kein Ausrufezeichen braucht.
Besonders eindrucksvoll ist die leise, aber unübersehbare Feier der Literatur, die sich durch den gesamten Roman zieht. Hier wird Schreiben nicht als Lifestyle-Accessoire behandelt, sondern als das, was sie im besten Fall ist: eine Überlebensstrategie. Nadolnys Figuren flüchten nicht in die Kunst, sie arbeiten sich an ihr ab, und finden darin jene Form von Trost, die nicht vorgibt, endgültig zu heilen.
„Herbstgeschichte“ ist ein Roman, der mit einer unmodischen Selbstverständlichkeit daran erinnert, warum Menschen überhaupt Geschichten erzählen: Weil sie ohne sie oft nicht wissen, wer sie sind. Melancholisch, weise, menschlich, und weit entfernt von jener sentimentalen Zuckerglasur, die man heutzutage viel zu oft als Tiefgang verkauft bekommt.
Ein Spätwerk, ja. Aber eines, das nicht nach Altersmilde schmeckt, sondern nach der konzentrierten Essenz eines langen Schreiblebens. Und wer Literatur sucht, die nicht mit erhobenem Zeigefinger belehren, sondern mit stiller Beharrlichkeit nachwirken will, findet hier ein Buch, das man nicht liest, sondern das einen eine Zeit lang begleitet.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 20. November 2025
