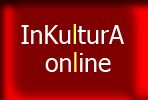Buchkritik -- Joe Pitkin -- Exit Black
 „Stirb langsam im Weltall", so lässt sich das Konzept von Joe Pitkins Science-Fiction-Thriller „Exit Black" am treffendsten beschreiben. Mit einer weiblichen Hauptfigur, die dem ikonischen John McClane in nichts nachsteht, verspricht der Roman eine explosive Mischung aus Action, Spannung und klaustrophobischer Bedrohung im Orbit der Erde. Doch die Umsetzung dieser vielversprechenden Prämisse erweist sich als zwiespältig und offenbart sowohl brillante Ideen als auch handwerkliche Schwächen.
„Stirb langsam im Weltall", so lässt sich das Konzept von Joe Pitkins Science-Fiction-Thriller „Exit Black" am treffendsten beschreiben. Mit einer weiblichen Hauptfigur, die dem ikonischen John McClane in nichts nachsteht, verspricht der Roman eine explosive Mischung aus Action, Spannung und klaustrophobischer Bedrohung im Orbit der Erde. Doch die Umsetzung dieser vielversprechenden Prämisse erweist sich als zwiespältig und offenbart sowohl brillante Ideen als auch handwerkliche Schwächen.
Imperium, die teuerste Struktur, die jemals gebaut wurde, schwebt als glitzerndes Symbol menschlichen Ehrgeizes im niedrigen Erdorbit. Einst ein hochmodernes Forschungslabor, dient die Station nun als exklusives Weltraumhotel für die Superreichen, ein Spielplatz für Milliardäre, Tech-Mogule und Instagram-Influencer, die sich den ultimativen Luxus leisten können: eine Woche im All für schlappe 85 Millionen Dollar. Dr. Chloe Bonilla, die ansässige Biophysikerin der Station, ist von dieser Entwicklung wenig begeistert. Die Ablenkung durch die verwöhnten Weltraumtouristen stört ihre Forschung, und sie fragt sich, ob das Babysitten dieses Personenkreises wirklich ihre Zeit wert ist. Doch als die erste Gruppe hochkarätiger Gäste eintrifft, nimmt die Geschichte eine tödliche Wendung. Unter dem Personal haben sich Mitglieder einer globalen Terroristengruppe eingeschlichen, die sich „Die Gerechten‟ nennen und gegen die wirtschaftliche Ungleichheit des 21. Jahrhunderts kämpfen. Die Terroristen übernehmen die Kontrolle über Imperium und fordern ein Lösegeld von acht Milliarden Dollar. Alle Geiseln und das übrige Personal werden in einem Raum zusammengepfercht, mit einer Ausnahme: Chloe, die aufgrund ihrer Schlaflosigkeit früh aufgewacht ist und sich noch frei auf der Station bewegt, als die „Die Gerechten‟zuschlagen. Nun liegt es an ihr, die Geiseln zu retten, bevor der einzige Ausweg aus der Station der tödliche Sprung ins Vakuum des Weltraums ist.
Das Konzept von „Exit Black" ist zweifellos faszinierend und hochaktuell. Die Idee, den klassischen Geiselnahme-Thriller in den Weltraum zu verlagern, bietet unzählige Möglichkeiten für Spannung und Drama. Die Raumstation als geschlossener, isolierter Schauplatz verstärkt das Gefühl der Ausweglosigkeit, und die Thematik der wirtschaftlichen Ungleichheit verleiht der Geschichte eine gesellschaftspolitische Dimension, die über reine Action hinausgeht. Pitkin greift hier ein brennendes Thema unserer Zeit auf und verpackt es in ein Genre, das normalerweise eher auf spektakuläre Effekte als auf soziale Kommentare setzt. Die Parallelen zu „Stirb langsam" sind offensichtlich und gewollt: Eine einzelne Person gegen eine Gruppe von Terroristen, die Geiseln genommen haben. Doch während John McClane in einem Hochhaus kämpfte, muss Chloe Bonilla in der Schwerelosigkeit und unter den lebensfeindlichen Bedingungen des Weltraums agieren. Diese Verlagerung des Settings eröffnet neue narrative Möglichkeiten, von der Nutzung der Stationsarchitektur bis hin zu den physikalischen Herausforderungen, die der Weltraum mit sich bringt.
Dr. Chloe Bonilla ist als Protagonistin eine interessante Wahl. Sie ist keine ausgebildete Soldatin oder Agentin, sondern eine Wissenschaftlerin, eine Biophysikerin, die sich plötzlich in einer Situation wiederfindet, für die sie nicht ausgebildet wurde. Sie leidet unter Schlaflosigkeit, kann stur sein, wenn sie herausgefordert wird, hat ein Gefühl der Distanziertheit und liebt Denksportaufgaben. Diese Eigenschaften machen sie zu einer glaubwürdigen Heldin, die nicht durch übermenschliche Kampffähigkeiten, sondern durch Intelligenz und Einfallsreichtum überzeugen muss. Ihre Kenntnis der Station und ihrer Systeme wird zu ihrer größten Waffe im Kampf gegen die Terroristen. Doch hier zeigt sich auch eine der größten Schwächen des Romans: Während Chloe auf dem Papier eine komplexe Figur ist, fehlt es ihrer Darstellung oft an emotionaler Tiefe. Die Charaktere wirken insgesamt flach und wie Karikaturen, ohne dass man sich wirklich für sie interessiert. Die Charakterentwicklung erfolgt in kurzen, unzusammenhängenden Rückblicken, die eher verwirren als erhellen und keine kohärente Entwicklung erkennen lassen.
Die Erzählstruktur des Romans ist ein zweischneidiges Schwert. Pitkin wählt multiple Perspektiven, die Einblicke in verschiedene Charaktere gewähren und die Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Diese Technik ermöglicht es, die Motivationen sowohl der Geiseln als auch der Terroristen zu zeigen. Gleichzeitig führt sie jedoch zu Zeitsprüngen, die den Fluss der Handlung unterbrechen und Spannung nehmen. Die Rückblenden verhindern, dass man sich vollständig in den Moment hineinversetzen kann, und schaffen eine Distanz, die der Intensität der Situation entgegenwirkt. Die Spannung selbst ist ungleichmäßig verteilt. Der Prolog zieht den Leser sofort in die Geschichte hinein, doch danach fällt das Tempo merklich ab. Erst etwa zur Hälfte des Buches nimmt die direkte Action wieder zu, doch selbst dann fehlt es an narrativer Dringlichkeit. Die Geschichte fühlt sich stellenweise langsam an und fließt nicht reibungslos. Es mangelt an emotionaler Resonanz, und die Ereignisse scheinen keine erkennbare Auswirkung auf die Charaktere zu haben. Menschen sterben, werden erschossen, doch diese dramatischen Momente entfalten nicht die Wirkung, die sie haben sollten, weil sie ohne grafische Details und ohne emotionale Verarbeitung präsentiert werden.
Der Schreibstil ist funktional, aber nicht elegant. Die Prosa ist einfach gehalten, was den Roman zwar zugänglich macht, aber literarisch anspruchsvollere Leser enttäuschen dürfte. Viele Passagen lesen sich wie eine Aufzählung von Handlungen: Sie tat dies. Sie tat das. Sie tat jenes. Es fehlt an Reflexion, an inneren Monologen, an der emotionalen Verarbeitung dessen, was geschieht. Die Erzählweise ist überwiegend „telling" statt „showing", was dazu führt, dass die Geschichte sich stellenweise wie ein Laborbericht anfühlt statt wie ein packender Thriller im Weltraum. Diese emotionale Kälte steht im starken Kontrast zu dem, was die Situation eigentlich erfordern würde: eine intensive, nervenzerreißende Erfahrung, bei der man mit der Protagonistin um ihr Überleben bangt.
Die technischen Aspekte des Romans sind gemischt. Das Worldbuilding ist grundsätzlich solide, und die Darstellung der Technologie erscheint für eine Zeit etwa 50 Jahre in der Zukunft plausibel. Die Raumstation Imperium wird detailliert beschrieben, und man bekommt ein gutes Gefühl für ihre Architektur und Funktionsweise. Allerdings gibt es auch Ungereimtheiten, die irritieren: Benutzen Menschen in der Zukunft wirklich noch Skype? Funktionieren Handys auf Raumstationen? Solche Details mögen nebensächlich erscheinen, doch sie fallen dem aufmerksamen Leser negativ auf. Zudem sind einige technische Szenen schwer nachvollziehbar, insbesondere für Leser ohne Vorkenntnisse über Raumfahrt. Die Szene, in der Chloe ein Ammoniak-Leck repariert, ist ein Beispiel dafür: Die Beschreibung ist so technisch und gleichzeitig so vage, dass man Schwierigkeiten hat, sich vorzustellen, was genau geschieht.
Trotz all dieser Kritikpunkte hat „Exit Black" durchaus seine Stärken. Die Grundidee ist originell und relevant, und die gesellschaftspolitische Dimension, der Kampf gegen wirtschaftliche Ungleichheit, verleiht der Geschichte eine Substanz, die über bloße Actionkost hinausgeht. Die Themen Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Einsamkeit, Beziehungen, Lügen und Geheimnisse werden angesprochen, wenn auch nicht immer mit der nötigen Tiefe. Der Epilog enthält einige Überraschungen, die unerwartet kommen und der Geschichte einen interessanten Abschluss geben. Das Buch funktioniert am besten, wenn man es als leichte, schnelle Unterhaltung betrachtet. Mit einer Lesedauer von etwa drei bis vier Stunden ist es ideal für einen Flug oder einen entspannten Nachmittag am Strand. Wer keine allzu hohen Ansprüche an literarische Qualität oder emotionale Tiefe stellt und einfach einen actionreichen Science-Fiction-Thriller suchen, wird hier durchaus auf seine Kosten kommen.
Letztendlich ist „Exit Black" ein Roman der verpassten Chancen. Die Prämisse ist brillant, das Setting faszinierend, und die gesellschaftspolitische Thematik verleiht der Geschichte Relevanz. Doch die Umsetzung bleibt hinter dem Potenzial zurück. Die emotionslose Erzählweise, die flachen Charaktere, der holprige Schreibstil und die ungleichmäßige Spannungskurve verhindern, dass das Buch die Wirkung entfaltet, die es haben könnte. Es ist weder ein Meisterwerk noch ein Totalausfall, sondern ein solides Genre-Werk mit deutlichen Höhen und Tiefen.
Für Fans von Science-Fiction-Action-Thrillern, die eine schnelle, unterhaltsame Lektüre suchen und bereit sind, über handwerkliche Schwächen hinwegzusehen, ist „Exit Black" eine akzeptable Wahl. Wer jedoch einen literarisch anspruchsvollen, emotional packenden Thriller erwartet, der die Messlatte von „Stirb langsam" oder „Der Marsianer" erreicht, wird enttäuscht werden. Joe Pitkin hat einen ambitionierten Versuch unternommen, den klassischen Action-Thriller ins Weltall zu verlagern und mit aktuellen gesellschaftlichen Themen zu verbinden, doch das Ergebnis ist ein Roman, der in seiner Ambivalenz mehr frustriert als fasziniert.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 28. Oktober 2025