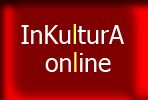Buchkritik -- Richard David Precht -- Angststillstand
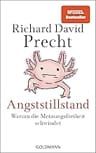 Richard David Precht hat ein Gespür für Zeitdiagnosen, die schmerzen. In „Angststillstand“ richtet er den Blick auf eine Gesellschaft, die sich, so seine These, nicht durch äußere Zensur, sondern durch innere Hemmung selbst zum Schweigen bringt. Nicht die politische Unterdrückung, sondern die seelische Verunsicherung sei das Signum unserer Gegenwart. Der Einzelne wagt kaum noch, zu widersprechen, aus Angst, andere zu verletzen oder selbst beschädigt zu werden. So verlerne man, was die Demokratie im Innersten zusammenhält: das produktive Streiten.
Richard David Precht hat ein Gespür für Zeitdiagnosen, die schmerzen. In „Angststillstand“ richtet er den Blick auf eine Gesellschaft, die sich, so seine These, nicht durch äußere Zensur, sondern durch innere Hemmung selbst zum Schweigen bringt. Nicht die politische Unterdrückung, sondern die seelische Verunsicherung sei das Signum unserer Gegenwart. Der Einzelne wagt kaum noch, zu widersprechen, aus Angst, andere zu verletzen oder selbst beschädigt zu werden. So verlerne man, was die Demokratie im Innersten zusammenhält: das produktive Streiten.
Precht formuliert diese Diagnose nicht als kulturpessimistisches Lamento, sondern als psychologische Bestandsaufnahme. Sein Ausgangspunkt ist die menschliche Angst, jenes uralte Gefühl, das, wenn es sich verfeinert und sozialisiert, zur moralischen Sensibilität wird, doch wenn es überhandnimmt, zur Lähmung führt. Der Autor beschreibt eine Gesellschaft, die sich in dieser Überfeinerung verheddert hat: moralisch hyperaktiv, emotional hypersensibel, intellektuell verunsichert. In den sozialen Medien, wo Empörung und moralische Selbstvergewisserung längst zur Ersatzhandlung politischer Partizipation geworden sind, findet diese seelische Überhitzung ihre Bühne.
Man kann Precht zugutehalten, dass er sich damit in ein vermintes Gelände wagt. Während andere Publizisten sich an der Oberfläche des Meinungsklimas abarbeiten, sucht er nach den psychischen Wurzeln des Phänomens: nach der Angst vor sozialer Isolation, vor öffentlicher Beschämung, vor moralischem Ausschluss. Damit verleiht er dem Diskurs eine Tiefendimension, die vielen Kommentatoren fehlt. Zahlreiche Leser loben denn auch seinen Mut, die Diagnose einer „inneren Zensur“ auszusprechen, wo die Mehrheit lieber von Toleranz und Empathie spricht.
Precht ist kein Revolutionär des Denkens, aber ein Stilist der Klarheit. Seine Sprache bleibt elegant, ohne in akademische Selbstgefälligkeit zu kippen; seine Argumente sind zugespitzt, aber nie platt. Er beherrscht die Kunst der Vereinfachung, ohne zu trivialisieren. Darin liegt, so sehen es viele positive Stimmen, die eigentliche Stärke dieses Buches: Es übersetzt die Komplexität psychologischer und gesellschaftlicher Prozesse in eine verständliche, zugleich reflektierte Form.
Das Titelmotiv des Axolotls, jenes mexikanischen Salamanders, der nie erwachsen wird, ist eine der markantesten Metaphern des Buches. Für Precht steht er als Sinnbild einer „infantilen Gesellschaft“, die in psychischer Unreife verharrt, zu empfindlich, um zu streiten, zu bequem, um zu reifen. Das ist brillant formuliert, aber auch riskant. Denn wer gesellschaftliche Sensibilität als Zeichen von Unmündigkeit deutet, gerät leicht in den Verdacht, berechtigte Empathie zu pathologisieren. Precht bewegt sich hier auf schmalem Grat zwischen Einsicht und Überzeichnung.
Doch gerade diese Ambivalenz macht den Reiz des Buches aus. „Angststillstand“ zwingt den Leser, die eigene Position zu prüfen: Gehört man zu jenen, die sich im Ton der Entrüstung gefallen? Oder zu denen, die aus lauter Angst vor einem falschen Wort lieber schweigen? Prechts Buch ist ein Spiegel, und nicht jeder hält den Anblick aus.
In der Rezeption ist dies auffällig: Wo einige Kritiker ihm moralische Überheblichkeit vorwerfen, loben andere seine Fähigkeit, die wunde Stelle unserer Zeit zu benennen. Viele Leser betonen, wie wohltuend es sei, ein Buch zu lesen, das weder in kulturpessimistisches Nörgeln noch in optimistische Beschwichtigung verfällt. Precht, so heißt es, liefere keine Rezepte, sondern öffne einen Raum für Selbstprüfung. Gerade in einer Ära der Lautsprecher und Empörungsketten sei das ein Akt geistiger Hygiene.
Gesellschaftsphilosophisch betrachtet, entfaltet „Angststillstand“ eine doppelte Bewegung: Es beschreibt den Zustand des öffentlichen Diskurses, und zugleich die innere Verfassung des modernen Subjekts. Beides hängt zusammen. Die äußere Sprachverarmung spiegelt die innere Verunsicherung. Wenn der Mensch den eigenen Affekten misstraut, beginnt er, sich selbst zu zensieren; er misst jede Äußerung am möglichen Shitstorm. So verwandelt sich die Demokratie, die vom Mut zur Differenz lebt, in eine Bühne der moralischen Uniformität.
Precht zeigt, dass die Ursachen dieser Entwicklung weniger in politischer Ideologie als in psychischer Disposition liegen. Das ist die eigentliche Originalität seines Buches. Wo andere über Cancel Culture debattieren, fragt er nach der emotionalen Ökonomie, die sie trägt. Der moralische Furor ist für ihn keine Modeerscheinung, sondern das Symptom einer verängstigten Gesellschaft, die ihre innere Leere mit Empörung füllt.
Gerade darin liegt, bei aller Kritik, das produktive Moment seiner Argumentation: Precht zwingt die Leser, die politische Psychologie unserer Zeit zu begreifen. Dass er dabei gelegentlich verallgemeinert oder den moralischen Aktivismus der Jüngeren zu rasch als Unreife deutet, ist weniger Schwäche als kalkuliertes Risiko. Der Autor will provozieren, nicht beruhigen, und genau das macht sein Buch lebendig.
In den Rezensionen vieler Feuilletons wird diese Spannung hervorgehoben: „Angststillstand“ sei kein Werk, das man abnickt, sondern eines, an dem man sich reibt. Es bringe das Paradox der Gegenwart auf den Punkt, die Gleichzeitigkeit von Überempfindlichkeit und Kälte, von moralischem Furor und emotionaler Verarmung. Dass Precht diese Widersprüche psychologisch statt ideologisch deutet, macht das Buch, trotz aller Vereinfachung, zu einem wichtigen Beitrag im Diskurs über Demokratie und Freiheit.
Am Ende bleibt ein Fazit, das ebenso beunruhigend wie tröstlich ist: Wenn die Angst die Gesellschaft lähmt, dann kann nur das Denken sie heilen, nicht als moralische Predigt, sondern als psychologische Selbstaufklärung. Precht hat kein Heilmittel verfasst, aber einen seelischen Befund geliefert, der genauer ist, als man zugeben möchte. Seine Leser spüren das: dass in dieser Analyse der Gegenwart etwas von jener Wahrheit steckt, die nur der auszusprechen wagt, der selbst keine Angst vor Widerspruch hat.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 4. November 2025