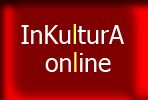Buchkritik -- Lavie Tidhar -- Adama
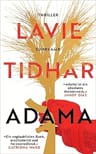 Lavie Tidhars Roman „Adama“ ist ein literarischer Faustschlag. Ein wütendes, brutales und zugleich tief trauriges Epos, das sich vorgenommen hat, nicht weniger als den Gründungsmythos Israels zu zertrümmern. Es ist ein Buch von ungeheurer Wucht, das einen ebenso sehr in seinen Bann schlägt, wie es abstößt, und das gerade deshalb von so brennender Notwendigkeit ist.
Lavie Tidhars Roman „Adama“ ist ein literarischer Faustschlag. Ein wütendes, brutales und zugleich tief trauriges Epos, das sich vorgenommen hat, nicht weniger als den Gründungsmythos Israels zu zertrümmern. Es ist ein Buch von ungeheurer Wucht, das einen ebenso sehr in seinen Bann schlägt, wie es abstößt, und das gerade deshalb von so brennender Notwendigkeit ist.
Der Titel selbst ist Programm. „Adama“, das hebräische Wort für Erde, für Land, birgt in seinem Klang bereits das Wort für Blut, „Dam“. Kein Land ohne Blut, diese unheilvolle Formel legt Lavie Tidhar wie ein Fundament unter seine Erzählung. Er folgt den Spuren dieses Blutes über mehr als sechzig Jahre, von den Aschefeldern Europas bis in die von Korruption und Gewalt zerfressene israelische Gegenwart. Im Zentrum steht der fiktive Kibbuz Trashim, ein Mikrokosmos des ganzen Landes, und seine Matriarchin Ruth. Sie ist eine Überlebende, eine Kämpferin, eine Gründerin. Doch ihr Idealismus erstarrt zu einer gnadenlosen Härte, die für den Erhalt des Landes bereit ist, alles zu opfern: die Menschlichkeit, die eigenen Kinder, die Seele.
Darin liegt die große, verstörende Stärke dieses Romans. Tidhar verweigert sich jeder heroischen Verklärung. Er zeigt die Pioniere nicht als strahlende Helden, sondern als traumatisierte, von Gewalt gezeichnete Menschen, deren Überlebenswille in einen neuen Kreislauf der Gewalt mündet. Die Vertreibung der arabischen Bevölkerung, die Kriege, die schmutzigen Geschäfte zwischen Politik, Geheimdienst und organisiertem Verbrechen, all das wird in einer nüchternen, fast protokollarischen Prosa ausgebreitet. Der Roman entwickelt einen unerbittlichen Sog, dem man sich kaum entziehen kann. Er zwingt uns, dorthin zu blicken, wo es wehtut, und konfrontiert uns mit der unbequemen Wahrheit, dass der zionistische Traum von Anfang an auf einem Fundament aus Gewalt und Verdrängung gebaut war.
Doch diese radikale Perspektive hat ihren Preis. In seinem Furor, die Lügen der offiziellen Geschichtsschreibung zu entlarven, verliert Tidhar bisweilen die Zwischentöne aus dem Blick. Seine Figuren wirken oft wie Archetypen ihrer Sache, getrieben von Rache, Hass und einem fanatischen Willen zur Macht. Ihre Seelenlandschaften bleiben seltsam unbeleuchtet, ihre Handlungen entspringen eher einer historischen Notwendigkeit als einer nachvollziehbaren psychologischen Tiefe. Man sehnt sich nach einem Moment der Ambivalenz, nach einem Riss in der Fassade dieser steinernen Charaktere, doch der Roman gewährt ihn nur selten. Die unaufhörliche Folge von Brutalität läuft Gefahr, den Leser abzustumpfen und das Grauen zu einer bloßen Stilübung verkommen zu lassen.
Auch stilistisch ist nicht alles Gold, was glänzt. Der harte, abgehackte Ton passt zwar zur Thematik, verfällt aber gelegentlich in repetitive Muster und bedient sich Klischees des Noir-Thrillers. Man spürt die Absicht, einen großen, schmutzigen Gegenentwurf zur Hochliteratur zu schaffen, doch manchmal wirkt dies mehr gewollt als gekonnt.
Und doch: Trotz dieser Einwände ist „Adama“ ein literarisches Ereignis. Es ist ein Roman, der schmerzt, weil er an den Grundfesten unserer Vorstellungen von Heimat, Opfer und Nation rüttelt. Er ist kein Buch, das man liebt, aber eines, das man nicht vergisst. Lavie Tidhar hat die Chronik eines gebrochenen Versprechens geschrieben, das Versprechen eines Landes, das seine Kinder verschlingt, weil es selbst aus Blut geboren wurde. Es ist ein zorniges, ein parteiisches, ein zutiefst aufwühlendes Buch. Und vielleicht ist es gerade deshalb das ehrlichste, das man derzeit über Israel lesen kann.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 13. November 2025